Entwicklung
Nach der erfolgreichen Einführung der Baureihe MY als Universallok auf den Hauptstrecken, plante die DSB ab 1957 auch die Motorisierung leichter Züge und der Nebenbahnen. Ausgangspunkt der Überlegungen war das EMD-Muster "G12", das als "Roadswitcher" mit schmalen Vorbauten sowie einem außermittigen Führerhaus und Steuerständen für beide Fahrtrichtungen ausgestattet war. Der Antrieb mit dieselelektrischer Transmission basierte auf dem bewährten Motor Modell GM 567 in der Ausführung mit 12 Zylindern. Bereits 1954 hatte EMD die eigens gefertigte Vorführlok EMD 7707 für Überseemärkte bei verschiedenen europäischen Bahnverwaltungen präsentiert. Diese Lok war an die hier üblichen Normen mit einem kleineren Lichtraumprofil und reduzierter Achslast angepaßt, entsprach aber noch nicht den dänischen Anforderungen. Hier wünschte man sich eine Lok mit Endführerständen und einem Dampferzeuger für die Zugheizung, die Achslast durfte den Wert von 16 t nicht überschreiten. Die Lok sollte Schnellzüge von 400 t mit 120 km/h und Güterzüge von 800 t mit 70 km/h fördern können. Schließlich forderte man 1957 den schwedischen Lokbauer "Nydqvist och Holm AB" (NOHAB) zu einem entsprechenden Angebot auf Basis der EMD G12 auf. NOHAB schlug eine Variante der zeitgleich von "Henschel & Sohn" für die ÖBB entwickelten Reihe 2050 vor, deren zweiachsige Drehgestelle mit einer zusätzlichen Laufachse ergänzt wurden, um die geforderte Achslast einzuhalten. Die äußere Gestaltung der Lok erfuhr während des Entwicklungsprozesses mehrfach Änderungen und man verständigte sich letztendlich auf das bewährte "Rundnasen"-Design. Das neue Muster war rund 10 t leichter als die MY infolge des kleineren Motors mit 12 statt 16 Zylindern und den verringerten Vorräten von Betriebsstoffen.

Die DSB bestellte 1959 bei NOHAB insgesamt 45 Loks auf Basis der EMD G 12 als Baureihe DSB MX, wobei auch dänische Hersteller an der Produktion beteiligt wurden. GM-EMD (34 %) lieferte den Dieselmotor, NOHAB (28 %) baute die Fahrzeugfronten mit den Führerständen und übernahm die Endmontage. Das dänische Kontigent (38 %) teilten sich "A/S Frichs" mit den Drehgestellen, dem Rahmen und dem Lokkasten sowie "Thomas B. Thrige" (TBT) mit dem Hauptgenerator und den Fahrmotoren. Die Auslieferung der Loks erfolgte 1960-62 innerhalb der vereinbarten Fristen. Aus der Erprobung ergaben sich nur geringfügige Nachbesserungen, von denen lediglich die geänderten Lüfteröffnungen äußerlich erkennbar waren. MX 1001-1020 wurden mit der Motorvariante GM 567C ausgeliefert, MX 1021-1045 erhielten das leistungsgesteigerte Modell GM 567D.
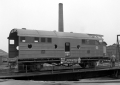
Einsatz
Die MX verdrängten veraltete Triebfahrzeuge vor Zügen aller Art, die nicht die volle Leistung der Baureihe MY erforderten. Im Nahverkehr um Kopenhagen betraf das vor allem die "Nord-" und die "Kystbanen", wo Dampfloks der Baureihe S ersetzt wurden. Dazu kamen Schnellzüge wie die internationalen Züge "Skandiapilen" und "Øresundpilen" sowie der Zubringer "Englænderen" für die Fähren ab Esbjerg und einige Lyntogverbindungen ("sorte lyntog"). Auf diesen Verbindungen wurden Triebwagen der Reihen MO und MK/FK abgelöst. Weitere Traktionsaufgaben fanden die MX u.a. vor den Eilgüterzügen Trans-Europ-Express-Marchandises (TEEM) und vor Postzügen. 1974-78 bespannten MX den TEE "Merkur" auf seiner dänischen Etappe zwischen Kopenhagen und Rødbyhavn, 1982-88 beförderten sie die Kohlezüge vom Seehafen Esbjerg zum Krafwerk "Herningværket" der I/S Vestkraft. Wegen ihrer geringen Lärmemission war die MX zusammen mit der MZ IV ab 1989 als einzige Muster für die Förderung der DanLink-Güterzüge durch die kopenhagener Wohngebiete zugelassen.




Im Laufe der Betriebsjahre erfuhren die MX verschiedene Modifikationen. Ab 1972 wurden MX 1011-1120 für den Regionalverkehr um Kopenhagen mit der ITC-Wendezugsteuerung sowie zusätzlichen Schlußleuchten und Wechselblinkleuchten des "Færdigmeldingssignal nr. 13" versehen. Das Zugsicherungssystem ATC wurde bei den MX dagegen nicht nachgerüstet, desgleichen unterblieb die Einführung der elektrischen Zugheizung. Nach dem katastrophalen Schneewinter 1978/79 wurden die Frontschürzen der Loks durch untergehängte Keilpflüge nach norwegischem Vorbild ersetzt. Insgesamt bewährten sich die MX als ökonomische und zuverlässige Loks, die auch mit häufigen Halten gut zurechtkamen.

MX am Gebrauchtmarkt
Mit der Ausrangierung bei der DSB war die aktive Zeit der MX nicht beendet, da die Loks auf großes Interesse der dänischen Privatbahnen stießen. Hier herrschte seit Mitte der 1980er Jahre ein Mangel an Zugkraft, es fehlten aber öffentliche Mittel für Neubeschaffungen. Unter diesen Voraussetzungen wurden die MX mit ihrer niedrigen Achslast zu einer kostengünstigen Lösung des Problems. Verschiedene Privatbahnen aus Dänemark und Schweden griffen zu und lernten die MX zu schätzen. Die Maschinen galten als "Die Lok, die einfach fuhr" und "...keinen Platz in der Werkstatt belegte". Die Einsatzfähigkeit wurde allerdings durch das Fehlen des Zugsicherungssystems ATC beschränkt, weshalb viele Betreiber später auf die ausrangierten Loks der Reihe MY umsattelten.
Museale Exponate
Die Ausrangierung der MX erfolgte 1987-93, wobei MX 1001 an Danmarks Jernbanemuseum abgegeben und MX 1035 als Denkmal in Struer aufgestellt wurde – letztere wurde 2014 ein Exponat im Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum, Struer.



Die norwegische Vereinigung "GM-gruppen i Norge" erwarb 1993 DSB MX 1040 als Museumslok. 2007 löste sich der Verein auf, die Lok wurde von der schwedischen "Bantåg Nordic AB" erworben und 2009 verschrottet.
Einführung
Teil 1: Entwicklung und Einsatz
Teil 2: Technische Beschreibung
ex DSB MX in Dänemark
ex DSB MX in Schweden
Fahrzeugliste
Zur Fahrzeug-Übersicht