

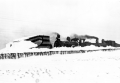





Schienenräumer
Um 1910 begann die DSB, die Schienenräumer ihrer Triebfahrzeuge mit Schneeschiebern in Forn schräggestellter Platten zu bestücken. Mit der Übernahme der SJ-Baureihe F (DSB E) lernte man ab 1937 dann die schwedische Ausführung der Schienenräumer mit gewölbten Pflugscharen zu schätzen. 1939 beschloß man, alle Triebfahrzeuge mit Druckluftbremse mit entsprechenden Pflugscharen auszustatten. Dies galt auch für die ab den 1950er-Jahren beschafften Steuerwagen der MO-Triebwagen.



Winter 1978/79
Ein einschneidendes Ereignis war das Extremwetter um Neujahr 1978/79, das in Norddeutschland und im südlichen Skandinavien als "Schneekatastrophe 1978/79" bzw. als "Snestormen 1978/79" in Erinnerung blieb. Der 3 Tage lang anhaltende Schneefall mit Starkwind brachte den Verkehr zum Erliegen und setzte zahlreiche Personen in eingeschneiten Kfz und Zügen fest. In Dänemark waren vor allem die Inseln Lolland und Falster sowie Südjütland betroffen, wo sich Schneewehen von bis zu 5 m Höhe auftürmten und es mehrere Tage brauchte, um den letzten festgefahrenen Zug zu befreien. Im Nachgang führte das Ereignis bei der DSB zu einer völligen Neuorganisation der Schneevorsorge, wobei man sich insbesondere an den Wintererfahrungen der norwegischen und schwedischen Bahnen orientierte. Neben organisatorischen Verbesserungen und der Einführung von beheizten Weichen, betrafen diese Maßnahmen vor allem das rollende Material.
Untergehängte Schneepflüge
Ab 1979 stattete die DSB ihre Fahrzeuge mit untergehängten Keilpflügen vom Typ "Norrlandsplove" nach norwegischem Vorbild aus, die sich bei moderater Schneehöhe als völlig ausreichend erwiesen. Deren Pflugschare waren gewölbt und deckten die gesamte Fahrzeugbreite ab. Entsprechend wurden alle Streckenloks und die Steuerwagen der Reihe Bns umgerüstet, die Triebwagen der Reihen MA und MR folgten später wegen des höheren konstruktiven Aufwandes. Dagegen blieben die Altbaureihen MO und deren Steuerwagen sowie alle anderen Triebfahrzeuge unverändert. Auch die Neubeschaffungen der folgenden Jahre waren entsprechend ausgestattet, sofern sie nach den Vorgaben der DSB konstruiert worden waren. Dies änderte sich ab den 2000er Jahren als man begann, Standardmuster verschiedener Hersteller zu beschaffen wie die Reihen MQ, EB, ES und die Doppelstock-Steuerwagen ABs. Die Stirnseiten dieser Fahrzeuge waren auch schneeabweisend ausgeformt, es wurde aber auf die dezidierten Keilpflüge verzichtet. Auch für den grenzüberschreitenden Verkehr waren untergehängten Schneepflüge ungeeignet, da sie das deutsche Lichtraumprofil überragten. So erhielten die 10 nach Deutschland verkauften Loks der Reihe MY neue Schneepflüge, bevor sie dort als Baureihe V 170 zugelassen wurden.



Schneevorsorge in den 2000ern
Die 1979 im Hinblick auf den vergangenen Katastrophenwinter getroffenen Maßnahmen zur Schneevorsorge wurden auf längere Sicht wohl als überdimensioniert bewertet. Nach dem baldigen Aus für die Schneeschleudern, wurde langfristig auch die Zahl der Schneepflüge reduziert. Mit der endgültigen Ausrangierung der Reihe MY war die DSB zum weiteren Betrieb ihrer Schneepflüge auf Mietloks angewiesen. Zum Räumen von Betriebsgeländen gab es Anbau-Schneefräsen, die u.a. von Zweiwege-Kfz eingesetzt werden konnten.

| Schneeräumung | ||
|
Træsneplove |
 |
Steckbrief |
|
Klima sneplove |
 |
Steckbrief |
|
Tender- / Scandiaplove |
 |
Steckbrief |
|
Snefræser |
 |
Steckbrief |
Quellen:
Andersen, Torben (2023): DSB specialvogne ca. 1933-1975. Lokomotivet årsskrift 2023: 4-28.
Christiansen, Asger (1985): De sjællandske Jernbaners første sneplov. Jernbanen 85/6: 144-146.
Christiansen, Asger (1992): Den første sneplov. Jernbanen 92/6: 164-165.
Dressler, Steffen (1997): DSB træsneplove. Jernbanemuseets venner 1996: 3-9.
Gösta Svensson, Gustav (2021): Bliver det hvidt jul? 50 ton sneplove står klar. Ingeniøren, https://ing.dk
N.N. (2012): Klimasneplove. Lokomotivet 107: 22-23.
OH (1979): DSB bliver bedre rustet til de kommende vintre. DSBbladet Nr. 9/1979: 13.
Zur Fahrzeug-Übersicht