"Det Sjællandske Jernbaneselskab" (SJS) beschaffte ab 1869 ebenfalls Træsneplove bei verschiedenen Herstellern, wählte aber eine Bauform mit einem führenden, zweiachsigen Drehgestell. Diese Modifikation versprach eine bessere Kurvengängigkeit und nahm die Schneelast gleichmäßiger auf. Spätere SJS-Schneepflüge wurden mit einem niedrigeren Aufbau beschafft, was die Streckensicht von der Schublok aus verbesserte. Die Betriebsergebnisse dieser Bauform überzeugten und so beschaffte auch die JFJ ab 1882 Schneepflüge mit Drehgestell, behielt aber den hohen Aufbau bei. In einigen Fällen wurde im Laufe der Betriebsjahre die Form und die Höhe des Aufbaus geändert. Die dänischen Privatbahnen beschafften ihrerseits Schneepflüge in verschiedenen Bauformen, entsprechend der technischen Lösungen von JFJ und SJS. Mit der Zusammenführung von JFJ und SJS in der DSB wurden die Schneepflüge in "Hovedtype" (Haupttypen) kategorisiert und erhielten eine einheitliche Nummerierung:
 |
Hovedtype I, DSB Nr. 1-28: 2-achsige Bauformen der JFJ |
 |
Hovedtype II, DSB Nr. 29-47: Drehgestell-Bauformen der JFJ |
 |
Hovedtype III, DSB 48-71: Drehgestell-Bauformen der SJS mit niedrigem Aufbau |
 |
Hovedtype IV, DSB Nr. 72-75: Schneepflüge der SFJ, die 1949 übernommen wurden |
Die Træsneplove wurden landesweit stationiert und bei Bedarf in Betrieb genommen. Fuhr sich ein Pflug fest, half nur Schaufeln. Das Ganze barg durchaus Gefahren, wie das Unglück bei Hansted 1876 zeigte, als ein Zug mit Hilfskräften auf ein feststeckendes Schneepflug-Gespann auffuhr und 9 Menschen getötet sowie 26 verletzt wurden. Insgesamt erwiesen sich die Træsneplove als erstaunlich langlebige Bauart und standen über 100 Jahre in Gebrauch. Die DSB erhielt 1920 die letzten 3 Schneepflüge und 1944 wurde das wohl letzte Exemplar an "De Bornholmske Jerbaner" als DBJ Sneplov 1 geliefert. Anfänglich erschienen die Træsneplove in dem für Güterwagen üblichen Rotbraun mit weißen Gleitflächen, ab 1929 erhielten sie ein Farbschema im Grau der Bahndienstfahrzeuge mit dunkelroten Streifen und schwarzen Anschriften. Der RHJ-Lokführer Jens Sørensen erfand 1938 eine Modifikation mit senkrecht stehenden Stahlprofilen an der Vorderkante des Schneepfluges. Diese brachen die anlaufenden Schneemassen auf und wirkten so dem Festfahren entgegen. Das System wurde von anderen Privatbahnen und vereinzelt auch von der DSB übernommen. Das Ausrangieren der Træsneplove begann in den 1960er Jahren und zog sich bis in die 1970er. Danmarks Jernbanemuseum bewahrte DSB Sneplov 8 (Hovedtype I, Scandia 1869)) aus Beständen der Privatbahnen blieben beim DJK SB Sneplov 1 (Marslev) und RHJ Sneplov 1 (Handest) erhalten.
| Technische Daten DSB "Træsneplove": | ||||
| Hovedtype I, DSB Nr. 1-28 | Hovedtype II, DSB Nr. 29-47 | Hovedtype III, DSB Nr. 48-71 | Hovedtype IV, DSB Nr. 72-75 | |
| Anzahl | 28 | 19 | 23 | 4 |
| Hersteller | JFJ, Scandia | Kockum, Scandia, Skabo | Scandia, Bergslund | Scandia, SFJ |
| Baujahre | 1867-77 | 1882-1900 | 1869-1920 | 1876-1910 |
| Achsfolge | 2 | 2' 1 | 2' 1 mm | 2 mm |
| Länge über alles | 8.680 mm | 7.515 mm | 7.210 mm | 8.900 mm |
| Achsstand | 3.912 mm | 3.960 mm | 3.670 mm | 3.950 mm |
| zul. Höchstgeschw. | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 45 / 60 km/h |
| Eigengewicht ohne Ballast | 12,5 t | 12,0 t | 12,5 t | 10,2 / 12,9 t |


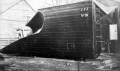













Bei den dänischen Privatbahnen versuchte man es gelegentlich auch mit mehr oder weniger überzeugenden Keilschneepflügen aus den eigenen Werkstätten.
Quellen:
Andersen, Torben (2023): DSB specialvogne ca. 1933-1975. Lokomotivet årsskrift 2023: 4-28.
Christiansen, Asger (1985): De sjællandske Jernbaners første sneplov. Jernbanen 85/6: 144-146.
Christiansen, Asger (1992): Den første sneplov. Jernbanen 92/6: 164-165.
Djursland Jernbanemuseum: Sneplov - RHJ. www.djbm.de
Dresler, Steffen (1997): DSB træsneplove. Jernbanemuseets venner 1996: 3-9.
Zur Fahrzeug-Übersicht