| Technische Daten MY 1101-1159: | |||
| Anzahl | 59 | ||
| Hersteller | NOHAB / GM | ||
| Baujahre | 1954-65 | ||
| Achsfolge | (Ao1Ao)' (Ao1Ao)' | ||
| Länge über Puffer | 18.900 mm | ||
| Drehzapfenabstand | 10.300 mm | ||
| Achsstand im Drehgestell | 4.000 (2.000 + 2.000) mm | ||
| Treib- / Laufrad-Ø | 1.015 mm | ||
| Motor | GM type 567B, 16 Zylinder, zweitakt GM type 567C, 16 Zylinder, zweitakt GM type 567D1, 16 Zylinder, zweitakt |
||
| Leistung | 1.100 kW (1.500 PS) bei 800 U/min 1.300 kW (1.750 PS) bei 835 U/min 1.433 kW (1.950 PS) bei 835 U/min |
||
| Anfahrzugkraft | 18 t | ||
| planmäßige Zugförderung | 1.200 t | ||
| Kraftübertragung | dieselelektrisch | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 133 km/h | ||
| Dienstgewicht | 101,6 t | ||
| max. Achslast | 18,0 t | ||
Design
Die Gestaltung der Baureihe MY basierte auf den EMD-"Bulldog Noses", also einem Design im "Art déco"-Stil, das Mitte der 1930er Jahre erschien. Der Einsatz in Europa erforderte aber die Modifikation des EMD Exporttyps AA16. So mußte der Lokkasten an die hier üblichen, kleineren Lichtraumprofile angepaßt werden, wofür u.a. die Traufkante des Daches abgesenkt und das Dach stärker gewölbt wurde. Gleiches galt für die Vorbauten, wodurch sich die charakteristische Form der Fenster des Führerstands ergab. Obwohl als Design nicht wirklich neu, bildeten die MYs in Dänemark einen starken Kontrast zu den bisher gewohnten Dampfloks und wurden in der öffentlichen Wahrnehmung zum Inbegriff der Moderne.
Lokkasten und Rahmen
Der geschweißte Lokkasten war als Gitterkonstruktion aufgebaut und bildete zusammen mit dem Rahmen die tragende Struktur. An jeder Stirnseite ermöglichte eine Tür den Übergang zu folgenden Wagen, was aber regulär nicht genutzt wurde. Neu war die Pufferbohle und eine entsprechend geänderte Rahmenkonstruktion, da reguläre Zug- und Stoßeinrichtungen verwendet wurden anstatt der in den USA üblichen Zentralkupplungen.






Unter den Pufferbohlen trugen die Loks eine Frontschürzen, die nach dem katastrophalen Schneewinter 1978/79 durch untergehängte Keilpflüge nach norwegischem Vorbild ersetzt wurden. Alle im aktiven Dienst verbliebenen MY erhielten ab 1994 Rangierplattformen über den Puffern und orange Blinkleuchten auf den Dächern für den sicheren Einsatz in Hafengebieten.


Drehgestelle
Die MY liefen auf dreiachsigen Drehgestellen mit "FlexiCoil"-Federung, die zuvor von der "Clyde Engineering" für den EMD-Exporttyp AA16 konstruiert worden waren. Durch die Ausführung mit 3 Radsätzen wurde die Achslast auf 18 t reduziert gegenüber den 25 t der zweiachsigen Vorlage. Die äußeren Radsätze wurden mit je einem Gleichstrom-Fahrmotor über Zahnräder angetrieben, der mittlere Radsatz war als Laufachse ausgeführt. Die Treibradsätze waren mit einer Drehzahlbegrenzung versehen, die Beschädigungen der Radreifen und Fahrmotoren beim Durchdrehen der Räder verhinderte. MY 1101-1104 erhielten Achslager der Bauart "Hyatt", alle folgenden wurden mit Rollenlagern von "Svenska Kullagerfabriken" (SKF) ausgestattet.





Motor
Als Motor der MY diente das Modell GM 567, ein langsamlaufender Zweitakt-Dieselmotor mit 16 Zylindern in 45° V-Stellung, der bei den ersten 5 Loks in der Version B (1.500 PS) verbaut wurde, die folgenden Loks waren mit den stärkeren Versionen C (1.750 PS) versehen, MY Serie IV erhielten die Version D1 (1.950 PS). Für die Leistungsangaben kennt die Literatur abweichende Werte, da zum einen die ungleichen Werte für europäische "Perdestärken" (PS) und amerikanische "horsepower" (hp) immer mal wieder verwechselt werden und zum anderen am Prüfstand gelegentlich höhere Leistungen als die Nominalwerte ermittelt wurden. Im Laufe der Betriebszeit wurden die Motoren vielfach getauscht, was die Verwirrung weiter steigerte. Der Verbrauch lag im Leerlauf bei 10-15 l/h und betrug bei Vollast 300-425 l/h, der Kraftstoffvorrat von 3.400 l entsprach einer Fahrzeit von bis zu 8 h.


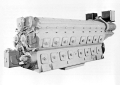
Schon bald nach der Einführung der MY gab es Beschwerden über den Lärm der Motoren, woraufhin "Danmarks Tekniske Højskole" sich des Problems annahm und die Schallemission um 10-12 dB reduzieren konnte. Die Maßnahmen zur Schalldämmung waren äußerlich an den spaltförmigen Auspufföffnungen erkennbar, die technische Ausführung übernahm die "Lydex AS". MY 1145-59 erhielten die Schalldämpfer ab Werk, von den bereits vorhandenen Loks wurden MY 1109, 1116 und 1123 nachgerüstet.


Kühlung
Die Kühlung des Dieselmotors erfolgte mit Wasser, das mit einem Volumen von 870 l mitgeführt wurde. Die Kühlluft wurde von 4 Lüftern durch die seitlichen Gitteröffnungen angesaugt und nach dem Durchströmen von 10 Wärmetauschern über 4 Öffnungen auf dem Dach ausgestoßen. Die Kühlwassertemperatur wurde von 4 Thermostaten überwacht, die die Lüfterdrehzahl regelten und die pneumatisch betriebenen Lamellen an den Lufteinlässen steuerten.
Generatoren
Der Hauptgenerator lieferte 950 V Gleichspannung für die Fahrmotoren und war direkt an den Motor angeflanscht, wobei der Anker des Generators auch als Schwungmasse des Motors diente. Beim Motorstart diente der Hauptgenerator als Anlasser, der aus den mitgeführten Batterien gespeist wurde. Der Hauptgenerator bildete eine bauliche Einheit mit dem Hilfsgenerator, der die Lüfterantriebe der Kühler und der Fahrmotoren mit 149 V 3-Phasen Wechselstrom versorgte. Ein weiterer Hilfsgenerator lieferte 75 V Gleichspannung mit einer Leistung von 18 kW zum Laden der Batterien, zur Beleuchtung sowie zum Betrieb verschiedener Steuereinrichtungen.
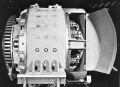
Steuerung und Zugsicherung
Die Regler der MY steuerte mit 8 Fahrstufen die Motordrehzahl zwischen 275 U/min (Leerlauf) und 800 U/min. Die MY waren mit der GM-Steuerung ausgestattet, die den Betrieb von bis zu 3 Loks in Mehrfachtraktion gestattete. Ab 1974 wurde bei der Mehrzahl der MY die ITC-Wendezugsteuerung eingeführt, die max. 2 Loks in Mehrfachtraktion zuließ. MY 1126 wurde zusammen mit MX 1021 und dem Steuerwagen Bhs 291 für die Erprobung des amerikanischen Zugsicherungssystems "Advanced Train Control System" (ACTS) von Motorola ausgewählt. Der Versuchsbetrieb 1989-90 wurde von der DSB gemeinsam mit der Computerfirma "Proco" auf einem reservierten Gleis am Güterbahnhof Kopenhagen durchgeführt, wobei die Loks mit einem IBM PC XT mit 8086 Prozessor ausgestattet wurden. Man erhoffte sich von der Technologie eine Energieeinsparung von 15 % und konnte den Zug auch führerlos mittels Ballisen und Funksignalen betreiben. Das System konnte Betriebsparameter zur Fehlerdiagnose aufzeichnen sowie alle Daten zur Platzreservierung und Fahrgastinformation verwalten. Aus Kostengründen wurde die weitere Entwicklung des Systems mit einem Großversuch nicht fortgesetzt und stattdessen das System "Automatic Train Control" (ATC) auf Basis der "ZUB 123" von Siemens eingeführt. 1995/96 wurde bei den 24 im aktiven Einsatz verbliebenen MY das ITC- gegen das ATC-Zugsicherungssystem von Siemens ausgetauscht.


Lichtsignale
Die MY waren mit einem Dreilicht-Spitzensignal ausgestattet, wobei die obere Leuchte in amerikanischer Designtradition größer ausgeführt war. Schlußleuchten gab es nicht, stattdessen wurden bei Bedarf transparente Vorsteckscheiben aus rotem Kunststoff vor den unteren Leuchten eingesetzt. Lediglich MY 1154 und 1156-1159 erhielten 1986/87 gesonderte Schlußleuchten für den Wendezugbetrieb im Nahverkehr um Kopenhagen. Des Weiteren erhielten die MY 1979 das "Færdigmeldingssignal" Nr. 13 für die Kommunikation zwischen Lok- und Zugführer, wobei seitlich an den Führerständen orange Blinkleuchten nachgerüstet wurden.



Zugheizung
Die MY waren mit einem ölgefeuerten Dampferzeuger der Bauart "Vapor-Clarkson" Typ OK 4625 der "Vapor Heating Corporatio" für die Zugheizung ausgestattet. Die Anlage erreichte innerhalb weniger Minuten ihren Betriebsdruck und lieferte stündlich bis zu 1.250 kg Dampf mit 7,5 kg/cm², der Wasservorrat der Dampfheizung betrug 4,5 m³. Mit der Umstellung auf elektrische Zugheizung wurden ab 1978 die Dampferzeuger ausgebaut und bei MY 1154-1159 gegen Generatorsätze getauscht. Diese wurden von einem 6-Zylinder MTU-Dieselmotor angetrieben und lieferten 3-Phasen Wechselstrom mit 1.500 V und 280 kW.
Farbliche Gestaltung und Schrifttypen
Mit Inbetriebnahme der Reihe MY führte die DSB ein eigenes Farbschema für ihre Strecken-Dieselloks ein in Weinrot mit cremefarbenen Zierlinien auf halber Höhe und an der Unterkante des Lokkastens. In späteren Betriebsjahren wurde auf die Zierlinien gelegentlich verzichtet, was als "sparemaling" (Sparbemalung) bezeichnet wurde. Das Dach und die Lüftergitter erschienen hellgrau, der Rahmen und die Drehgestelle waren schwarz gehalten. An den Stirnseiten wurde das DSB-Flügelrad mit Krone in Gelb geführt, die Fahrzeugnummer darunter wurde erst ab 1957 angeschrieben auf Anregung seiner Majestät König Frederik IX. von Dänemark. Für den DSB-Schriftzug und die Betriebsnummern wurde zunächst der traditionelle Antiqua-Schriftschnitt verwendet, ab 1965 wurde der Grotesk-Schriftschnitt DIN 1451 verwendet. Das 1972 eingeführte "Design"-Farbschema präsentierte die Loks in Schwarz mit roten Endstücken sowie den Anschriften in weißer Helvetica. Uneinigkeit bestand in der Farbgebung für die Pufferbohlen, die auf Seeland schwarz, westlich des Großen Belts rot lackiert wurden. Die Umstellung auf das neue Farbschema begann 1973 mit MY 1147 und wurde erst 1985 mit MY 1144 abgeschlossen. Ab 1994 erhielten die im Einsatz verbliebenen MYs Namen bei der Instandsetzung, wobei die Werkstattcrew die Namen ihrer Ehefrauen und Töchter verewigte.


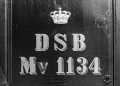



MY 1126 wurde 1989-90 für die Erprobung des Zugsicherungssystems "Advanced Train Control System" (ACTS) ausgesondert und erhielt zusammen mit MX 1021 und dem Steuerwagen Bhs 291 für diesen Einsatz eine individuelle Sonderlackierung. Das "Grafitti"-Design war inspiriert von elektronische Bauelementen und stammte von der Künstlerin Lilian Adler. Frau Adler studierte damals Möbeldesign an einer Schule für Gebrauchskunst und erhielt den Auftrag auf Empfehlung ihrer Dozenten. Die Entwurfsarbeit erfolgte in enger Abstimmung mit der Entwicklungsabteilung der DSB. Nach dem Ende des Versuchsprogramms behielten alle 3 Fahrzeuge ihre exklusive Gestaltung.




Einführung
Teil 1: Entwicklung
Teil 2: Einsatz
Teil 3: Technische Beschreibung
ex DSB MY in Dänemark
ex DSB MY in Schweden
ex DSB MY in Deutschland und Ungarn
Fahrzeugliste
Zur Fahrzeug-Übersicht