Schon zu Beginn der Eisenbahnzeit bestand die Notwendigkeit, Schienenfahrzeuge gelegentlich auf der Straße zu transportieren, da nicht alle Lok- und Waggonbauer über eigene Gleisanschlüsse verfügten. Dabei wurden spezielle Schwerlastfuhrwerke verwendet, als Zugkraft dienten anfänglich bis zu 30 Pferde oder Ochsen, später wurden Straßendampfwalzen und Kraftwagen eingesetzt. In jedem Fall handelte es sich um aufwändige Sondertransporte, nicht um alltagstaugliche Verkehrsformen. Einzelne Güterwagen wurden mit Tiefladern und Sattelschleppern befördert, was aber nur mit leichteren Waggons praktikabel war. Gelegentlich wurden Waggons auch mit Rollböcken auf Straßenbahn- und Schmalspurgleisen transportiert, aber damit waren nicht alle Frachtkunden erreichbar. Als weitestgehend unbrauchbar erwiesen sich alle Anssätze mit Zweiwegefahrzeugen.
Für den regelmäßigen Transport von Güterwagen auf der Straße galt es, die besonderen Anforderungen des Straßenverkehrs zu meistern:
 |
Gute Wendigkeit bei Kurvenfahrt und zum Rangieren auf engen Werkshöfen.
|
 |
Flexible Bodenanpassung mit gefederten Rädern zum Überfahren von Bordsteinkanten etc.
|
 |
Niedrige Bauhöhe zum Durchfahren von Unterführungen und Oberleitungen.
|
 |
Geringe Radlast und gleichmäßige Lastverteilung zur Schonung der Fahrbahn.
|
Die gleichmäßige Lastverteilung auf eine größere Anzahl von Rädern schloß die bisher übliche Bauform eines zweiachsigen Wagens mit Drehschemellenkung aus. Lösungen mit mehrachsigen Drehgestellen entfielen ebenfalls, da hier die Räder beim Einlenken seitlich über die Fahrbahn gleiten würden, was deren Einschlagen im Stand verhinderte. Stattdessen bedurfte es der bei Kfz üblichen Achsschenkellenkung, die durch die Auslenkung der Deichsel gesteuert wurde. Dabei benötigten die Räder einen ausreichenden senkrechten Federweg zum Ausgleich von Unebenheiten der Fahrbahn. Alle Überlegungen bezogen sich auf zweiachsige Güterwagen als Transportgut.
Nach Erteilung des Patents DRP 588 620 stellte Johann Culemeyer 1933 am Anhalter Güterbahnhof Berlin seinen ersten Straßenroller vor, den er für die DRG in Zusammenarbeit mit der "Gothaer Waggonfabrik AG" sowie der "Waggon- und Maschinenbau AG Görlitz" entwickelt hatte. Er beschrieb das Fahrzeug als "... einen einheitlichen, in sich unverdrehbaren, ausziehbaren Gleiswagen mit unterteilter durchgehender Fahrbahn". Tatsächlich war der Rahmen in 2 Fahrgestelle unterteilt, die entweder kurzgekuppelt als geschlossenes Fahrzeug oder getrennt gefahren werden konnten. In letzteren Fall wurden die Zugkräfte vom mitgeführten Eisenbahnwaggon aufgenommen, eine ausziehbare Steuerwelle zwischen den Fahrgestellen übertrug durch Rotation den Einschlagwinkel der Deichsel zum Einlenken der Räder. Auf diese Weise ließ sich das Fahrzeug an beliebige Achsstände anpassen. Jedes Fahrgestell trug 2 Gleisprofile zur Aufnahme des zu ladenden Waggons. Die Gleisprofile waren mehrteilig und ließen sich V-förmig in der Mitte hydraulisch absenken. Damit zentrierte sich der Radsatz des Waggons im Fahrgestell und konnte dort mit ausfahrbaren Achsgabeln fixiert werden. Diese mechanische Vorrichtung wurde aber bald aufgegeben und durch einteilige Gleisprofile mit verschiebbaren Radfestlegeklötzen ersetzt.

Jedes der beiden Fahrgestelle ruhte auf 2 Gruppen von 4 nebeneinander angeordneten Rädern, die paarweise auf pendeld gelagerten Kurzachsen saßen. Die Räder waren für eine kompakte Bauform mit Vollgummireifen versehen, die Federung erfolgte durch die Tragfedern an den Lagern der Kurzachsen. Jedes einzelne Rad war mit einer Achsschenkellenkung versehen und wurde bei Kurvenfahrt in Abhängigkeit seiner jeweiligen Position auf dem Kreisbogen eingelenkt. Die Lenkbewegungen der Räder wurden durch einen Zahnradlenkgetriebe im Fahrgestell kontrolliert. Dabei diente der Einschlagwinkel der Deichsel als Steuersignal, das über eine um ihre Längsachse drehbare Steuerwelle zwischen den Fahrgestellen übertragen wurde. Das Fahrzeug war mit einer vereinigten Luft-Öl-Bremse der Hersteller Knorr und Ate-Bremse ausgestattet, jedes Rad war mit einer Trommelbremse versehen. Das Gewicht beider Fahrgestelle lag bei 8 t, die maximale Zuladung wurde mit 40 t angegeben. Die Höchstgeschwindigkeit war zunächst auf 16 km/h beschränkt und wurde 1934 auf 25 km/h erhöht. Tatsächlich fuhr man nicht mehr als 20 km/h, da die gesetzlichen Vorgaben für höhere Geschwindigkeiten eine leistungsfähigere Bremsanlage erfordeten. Der kleinste befahrbare Radius betrug 6,5 m.
Das Verladen der Waggons auf die Straßenroller erfolgte an sogenannten Übersetzanlagen mit einer entsprechenden Gleisrampe, die den zu verladenden Waggon auf das Gleisniveau des Straßenrollers brachte. Entsprechende Baumaßnahmen waren daher an jedem Umschlagpunkt erforderlich, von dem aus der Lieferdienst angeboten werden sollte. Bei den später aufkommenden Straßenrollern mit einteiligem Rahmen bestand auch die Möglichkeit, einen Waggon direkt auf Gleisen mit Fahrbahnniveau mittels einer mobilen Rampen umschlagen zu können. Zum Abstellen der Waggons beim Kunden wurden mobile Absetzgleise angeboten, die sich auf klappbaren Rädern leicht verfahren ließen und eine flexible Positionierung auf dem Werksgelände erlaubten. Zum Bewegen der Waggons beim Übersetzen waren die Zustellfahrzeuge mit Seilwinden ausgestattet, der Verladevorgang konnte in 6-10 Minuten durchgeführt werden.
Aufbauend auf seinen konstruktiven Lösungen, setzte Johann Culemeyer die Entwicklung seiner Straßenroller stetig fort und so entstanden verschiedene Typen bei der Gothaer Waggonfabrik: Der ab 1933 gebaute zweiteilige R40 verfügte insgesamt über 16 Räder auf 4 Achsen und nahm ein Ladegewicht von 40 t auf. 1935 folgte der ebenfalls zweiteilige R80 mit 24 Rädern und 6 Achsen und einer Tragfähigkeit von 80 t. Mit diesem ließen sich nun auch die vierachsigen Großraum-Selbstentladewagen der Bauart OOt Oldenburg ausliefern. Der erste einteilige Straßenroller R41 von 1938 mit 16 Rädern auf 4 Achsen und 40 t Zuladung blieb dagegen ein Einzelstück. Die einteilige Bauform setzte sich erst ab 1942 mit dem Typ R42 durch mit 12 Rädern auf 6 Achsen und einer Tragfähigkeit von 40 t. Dieser Typ basierte auf einem Vorschlag der "Waggon- und Maschinenbau AG" (WUMAG) in Görlitz und zeichnete sich durch eine vereinfachte Bedienbarkeit aus. Außerdem konnte hier das Zahnradlenkgetriebe entfallen und das Einschlagen der Räder bei Kurvenfahrt ausschließlich mittels Lenkhebeln erreicht werden. Der Typ R42 wurde in 80-120 Exemplaren gebaut und kam meist bei Schwerlasttransporten der Wehrmacht zum Einsatz.



Der Betrieb der Straßenroller erforderte spezielle Schleppfahrzeuge, die aber nicht als marktübliche Muster verfügbar waren und von der DRG bei "Kaelble" und "Henschel" als Entwicklung beauftragt wurden. Gefordert waren Fahrzeuge mit hoher Anfahrzugkraft und guter Wendigkeit, um an den Überladerampen präzise manövrieren zu können. Folglich zeichneten sich alle Modelle durch einen kurzen Achsstand und einen großen Einschlag der Vorderräder aus. Anfänglich wurden Vollgummireifen verwendet, die aber schon bald wegen der besseren Oberflächenreibung durch Luftreifen ersetzt wurden. Die verbauten Motorleistungen waren mit 65 und 100 PS moderat, die Kraftübertragung erfolgte über ein 5-Gang Schaltgetriebe. Lediglich ein Sonderfahrzeug für Schwerlasttransporte leistete 180 PS und verfügte über ein 6-Gang Getriebe. Besondere Ausstattungsmerkmale der Straßenroller-Zugmaschinen waren eine Seilwinde, Ballast über den Antriebnsrädern sowie eine Besandungsvorrichtung gegen das Durchdrehen der Räder. Hinzu kamen seitlich ausziehbare Positionsleuchten, Pendelwinker und Rückspiegel, die für Fahrten als Gespann mit Überbreite benötigt wurden. Die Kabine bot neben dem Fahrer Platz für 2 weitere Begleitkräfte. 1938 verfügte man über 38 Fahrzeuge mit 65 PS, 165 Fahrzeuge mit 100 PS (davon 2 Sattelschlepper) sowie ein Sonderfahrzeug mit 180 PS.


Johann Culemeyer stellte vielfältige Überlegungen an, wie sich der Gebrauch der Straßenroller weiter verbessern ließe. So versuchte man die Entladung von Schüttgut wie Kohle oder Kies mit einer Kippvorrichtung über das hintere Fahrzeugende zu beschleunigen. Selbstfahrende Ausführungen sollten das Gesamtgewicht des Gespanns zur Schonung des Fahrbahnbelages verringern. WUMAG präsentierte ein Konzept als Sattelschlepper, die Gothaer Waggonfabrik stellte ein Fahrzeug mit Eigenantrieb vor. Es wurden verschiedene Musterfahrzeuge erprobt, von denen aber keines die Serienreife erreichte.

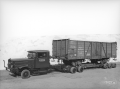



Einführung
Teil 1: Culemeyer-Patent
Teil 2: Straßenroller der DRG, DB, DR
Teil 3: DSB-"Vognbjørn"