Zu den Zeiten, als sich der Klimawandel sich noch nicht bemerkbar machte, stellte der Winterbetrieb die dänischen Eisenbahnen vor beachtliche Herausforderungen. Dabei blieben immer wieder Züge in meterhohen Schneeverwehungen stecken und blockierten die Strecken tagelang. Zunächst versuchte man sich mit Schneepflug-Aufsätzen zu behelfen, die bei Bedarf an dafür eingerichtete Loks und Wagen montiert wurden. War ein Zug festgefahren, wurden Arbeitskräfte angeheuert um den Zug freizuschaufeln. Die Grenzen dieses Systems zeigten sich im Schneewinter 1866/67, als allein die SJS 3.000 Hilfskräfte rekrutierte und zu deren Transport 8 Loks mit entsprechenden Wagen bereit stellte. Trotz des erheblichen Aufwandes und der Kosten kam es zu wochenlangen Betriebsausfällen und Schäden durch bis zu 5 m hohe Schneeverwehungen. Damit erschien die Beschaffung von dezidierten Schneepflügen auf eigenen Achsen als unausweichlich.
Als erste begannen "De Jydsk-Fyenske Jernbaner" (JFJ) 1867 mit dem Bau zweiachsiger Schneepflüge in ihren eigenen Werkstätten. Später bestellte man dann wie "Det Sjællandske Jernbaneselskab" (SJS) bei Hvide Mølle bzw. Scandia und Kockums Schneepflüge nach österreichischen Vorlagen. Bei den dänischen Privatbahnen folgte man den Lösungen der JFJ und SJS bzw. der DSB.




Keilschneepflüge
Bei allen in Dänemark beschafften Schneepflügen des 19. Jhdts. handelte es sich um Fahrzeuge mit Keilwirkung, wobei ein waagerechter Keil zunächst die Schneedecke anhob, die dann durch einen senkrechten Keil geteilt und seitlich abgeworfen wurde. Die Ausformung der Keile war uneinheitlich, da eine optimale Lösung noch gesucht wurde. Der Aufbau bestand aus einer stabilen Holzkonstruktion, die mit Eisenblech verkleidet wurde und eine Höhe von bis zu 3 m erreichte. An der Rückseite des Aufbaus gab es eine Luke, durch die Ballast zugeladen werden konnte. Die Länge der Fahrzeuge variierte um 8 m, das Gewicht inkl. Ballast lag bei 16 t. Diese Bauform erzielte brauchbare Räumleistungen, hatte aber gewisse Nachteile. So behinderte die Höhe der Schneepflüge die Streckensicht von der Schublok, sodaß der Schneepflugführer auf dem Tender platziert wurde, von wo aus er mit dem Lokführer kommunizierte. Weiterhin führten die beim Festfahren in einer Schneewehe entstehenden Kräfte gelegentlich zu einem Bruch der vorderen Achse. Daher entschied die SJS, diese durch ein zweiachsiges Drehgestell zu ersetzen - eine Bauform, die dann auch von der JFJ aufgegriffen wurde.





Insgesamt beschaffte die JFJ 34 und die SJS 13 Schneepflüge, die 1893 in den Bestand der DSB übergingen, die ihrerseits bis 1920 weitere Exemplare dieser Bauart bei Scandia bestellte und 1933 in ihren Bestand 99 Exemplare zählte. Ab 1920 erhielten die Schneepflüge das graue Farbschema mit dunkelroten Streifen, sie durften bei Überführungsfahrten mit 60 km/h bewegt werden. Die Schneepflüge wurden landesweit stationiert und bei Bedarf in Betrieb genommen, letzte Vertreter dieser Bauart fanden sich noch um 1970 im Bestand. Fuhr sich ein Pflug fest, half nach wie vor nur Schaufeln. Das Ganze barg durchaus Gefahren, wie das Unglück bei Hansted 1876 zeigte, als ein Zug mit Hilfskräften auf ein feststeckendes Schneepflug-Gespann auffuhr und 9 Menschen getötet sowie 26 verletzt wurden.


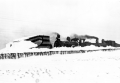




Schienenräumer
Um 1910 begann die DSB, die Schienenräumer ihrer Triebfahrzeuge mit Schneeschiebern in Forn schräggestellter Platten zu bestücken. Mit der Übernahme der SJ-Baureihe F (DSB E) lernte man ab 1937 dann die schwedische Ausführung der Schienenräumer mit gewölbten Pflugscharen zu schätzen. 1939 beschloß man, alle Triebfahrzeuge mit Druckluftbremse mit entsprechenden Pflugscharen auszustatten. Dies galt auch für die ab den 1950er-Jahren beschafften Steuerwagen für die MO-Triebwagen.



Klima-Schneepflüge, Bauart DSB
In den 1930er Jahren erwiesen sich die alten Schneepflüge der DSB als zu leicht für die immer stärker werdenden Lokomotiven und man entschloß sich, zwei neue Einheiten nach dem System "Klima" anzuschaffen. So baute die DSB 1957 zwei entsprechende Räumgeräte auf den Rahmen der ausrangierten Loks D 887 und 884 auf, deren neue Aufbauten mit einem Bedienstand sowie einem Mannschafts- und einem Technikraum eingerichtet wurden. Die Fahrzeuge wurden als DSB Sneplov 98-99 in Næstved und Aalborg stationiert, ihr letzter Einsatz erfolgte 1978/79, bevor sie 1981 ausrangiert wurden.







Tender-Schneepflüge
In den 1960er Jahren wurde eine Ablösung der alten Schneepflüge aus dem 19. Jhdt. immer dringlicher. Als Übergangslösung wurden 26 vierachsige Tender Typ III von ausrangierten Dampfloks der Reihen P, PR, R, H entsprechend 1964-71 umgerüstet als DSB Sneplov 101-126. Von Scandia folgte 1975-76 eine weitere Serie vergleichbarer Fahrzeuge als DSB Sneplov 127-132, wobei es sich aber um Neubauten handelte. Auch diese hatten einen starren Rahmen mit 4 Achsen, als Ballast dienten 4 Betonblöcke. Die Schneepflüge wogen rund 50 t und waren an einer Stirnseite mit senkrechten Räumschilden ähnlich dem System Klima ausgestattet, allerdings ohne dessen pneumatischen Verstellmöglichkeiten. Die Fahrzeuge wurden paarweise mit einer zwischengesetzten Diesellok eingesetzt, so daß der Verband in beiden Fahrtrichtungen arbeiten konnte.





Winter 78/79
Um Neujahr 1978/79 traf ein Extremwetterereignis auf Norddeutschland und das südliche Skandinavien, das als "Schneekatastrophe 1978/79" bzw. als "Snestormen 1978/79" in Erinnerung blieb. Der 3 Tage lang anhaltende Schneefall mit Starkwind brachte den Verkehr zum Erliegen und setzte zahlreiche Personen in eingeschneiten Kfz und Zügen fest. In Dänemark waren vor allem die Inseln Lolland und Falster sowie Südjütland betroffen, wo sich Schneewehen von bis zu 5 m Höhe auftürmten und es mehrere Tage brauchte, um den letzten festgefahrenen Zug zu befreien. Im Nachgang führte das Ereignis bei der DSB zu einer völligen Neuorganisation der Schneevorsorge, wobei man sich insbesondere an den Wintererfahrungen der norwegischen und schwedischen Bahnen orientierte. Neben organisatorischen Verbesserungen und der Einführung von beheizten Weichen, betrafen diese Maßnahmen vor allem das rollende Material.
Untergehängte Schneepflüge
Ab 1979 stattete die DSB ihre Flotte mit untergehängten Keilpflügen nach norwegischem Vorbild aus, die sich bei moderater Schneehöhe als völlig ausreichend erwiesen. Deren Pflugschare waren gewölbt und deckten die gesamte Fahrzeugbreite ab. Entsprechend wurden alle Streckenloks und die Steuerwagen der Reihe Bns umgerüstet, die Triebwagen der Reihen MA und MR folgten später wegen des höheren konstruktiven Aufwandes. Dagegen blieben die Altbaureihen MO und deren Steuerwagen sowie alle anderen Triebfahrzeuge unverändert. Auch die Neubeschaffungen der folgenden Jahre waren entsprechend ausgestattet, sofern sie nach den Vorgaben der DSB konstruiert worden waren. Dies änderte sich ab den 2000er Jahren als man begann, Standardmuster verschiedener Hersteller zu beschaffen wie die Reihen MQ, EB, ES und die Doppelstock-Steuerwagen ABs. Die Stirnseiten dieser Fahrzeuge waren auch schneeabweisend ausgeformt, es wurde aber auf die dezidierten Keilpflüge verzichtet. Auch für den grenzüberschreitenden Verkehr waren untergehängten Schneepflüge ungeeignet, da sie das deutsche Lichtraumprofil überragten. So erhielten die 10 nach Deutschland verkauften Loks der Reihe MY neue Schneepflüge, bevor sie dort als Baureihe V 170 zugelassen wurden.



Scandia-Schneepflüge
Bei den Einsätzen im Schneewinter 1978/79 zeigte sich, daß die Struktur der alten Tenderschneepflüge den Belastungen nicht mehr gewachsen war, woraufhin die Fahrzeuge ausrangiert wurden. Demgegenüber bewährten sich die Scandia-Neubauten, die nun mit effektiveren Keilpflügen mit einer Breite von 3.050 mm versehen wurden. Weiterhin erhielten die Fahrzeuge hochgesetzte Spitzensignale, die nächtliches Arbeiten ermöglichten. 1981-83 folgte eine weitere Serie dieser modernisierten Version mit den Nummern 133-145, die nun als Bahndienstfahrzeuge der Reihe DSB Tjenestevogne 980 3 (Gattung Bafd: Specialvogne mit 4-6 Achsen) geführt wurden. Der Einsatz der Scandia-Schneepflüge war ab einer Schneehöhen von 70 cm vorgesehen. Es wurden bevorzugt die Baureihen MY und MX eingesetzt, deren auf Pufferhöhe gelegene Rahmen eine besondere Längssteifigkeit aufwiesen. Die Baureihe MZ war dagegen ungeeignet, da deren Rahmen Gefahr lief von den Druckstößen beim Durchfahren von Schneewehen geknickt zu werden. Ein Gespann von 2 Schneepflügen und einer MY hatte ein Gewicht von rund 200 t und erreichte bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von 60 km/h eine ausreichende kinetische Energie, um alle Schneewehen zu durchbrechen. Der vorerst letzte Einsatz erfolgte im Winter 2009/10.
| Technische Daten Scandia-Schneepflüge: | |
| Anzahl | 19 |
| Hersteller | Scandia |
| Baujahre | 1975-76, 1981-83 |
| Länge über Puffer | 8.950 mm |
| Achsstand | 4.800 mm (1.600 mm + 1.600 mm + 1.600 mm) |
| zul. Höchstgeschw. | 60 km/h |
| Eigengewicht | 51,0 t |








Schneeschleudern
Die DSB evaluierte in Folge des Schneewinters 1978/79 die Beschaffung von Schneeschleudern (Rotor längs zur Fahrtrichtung) und Schneefräsen (Rotor quer zur Fahrtrichtung) in Form von Anbaugeräten und eigenständigen Fahrzeugen. Die Wahl fiel auf eine Schneeschleuder norwegischen Fabrikats mit 2 nebeneinanderliegenden Rotoren, die von einem Motor mit einer Leistung von 350 PS angetrieben wurden. Die Rotoreinheit war hydraulisch höhen- und seitenverstellbar, der Auswurfschacht war schwenk- und neigbar ausgeführt. Das Aggregat wurde bei Scandia auf dem Rahmen eines Güterwagens der Gattung Gklms montiert und war auf einem Drehzapfen gelagert. So ließ sich die Vorrichtung schwenken und war in beiden Fahrtrichtungen nutzbar. Der Arbeitsbereich war für bis zu 3 m Schneehöhe geeignet, als Schubkraft reichte ein einfaches Bahndienstfahrzeug aus. 1979-81 wurden 4 Schneeschleudern dieser Bauart beschafft und als DSB Snefræser 3001-3004 eingereiht. Die Fahrzeuge wurden bereits 1987/88 ausrangiert (?), mindestens ein Exemplar wurde von Banedanmark übernommen.
| Technische Daten DSB-Schneeschleudern: | |
| Anzahl | 4 |
| Hersteller | Scandia |
| Baujahre | 1979-81 |
| Länge über alles | 9.440 mm |
| Achsstand | 3.300 mm |
| zul. Höchstgeschw. | 45 km/h |
| Eigengewicht | 33,5 t |


Schneevorsorge in den 2000ern
Die 1979 im Hinblick auf den vergangenen Katastrophenwinter getroffenen Maßnahmen zur Schneevorsorge wurden auf längere Sicht wohl als überdimensioniert bewertet. Nach dem baldigen Aus für die Schneeschleudern, wurde langfristig auch die Zahl der Schneepflüge abgebaut. 2017 wurden 10 der Scandia-Schneepflüge vom Infrastrukturbetreiber "Banedanmark" übernommen, der 4 einsatzfähige Paare in Roskilde, Aarhus, Herning und Odense stationierte. Zwei weitere Schneepflüge erwarb die VLTJ, ein Schneepflug blieb bei Danmarks Jernbanemuseum. Alle übrigen Fahrzeuge wurden 2005/06 verschrottet. Das Museum verfügte zeitweilig über 2 Schneepflüge, so daß man mit den betriebsfähigen Museumsloks der Reihe MY eigene Räumdienste auf Mietbasis anbieten konnte. Mit der endgültigen Ausrangierung der Reihe MY war die DSB zum weiteren Betrieb ihrer Schneepflüge auf Mietloks angewiesen. Zum Räumen von Betriebsgeländen gab es Anbau-Schneefräsen, die u.a. von Zweiwege-Kfz eingesetzt werden konnten.


Quellen:
Andersen, Torben (2023): DSB specialvogne ca. 1933-1975. Lokomotivet årsskrift 2023: 4-28.
Christiansen, Asger (1985): De sjællandske Jernbaners første sneplov. Jernbanen 85/6: 144-146.
Christiansen, Asger (1992): Den første sneplov. Jernbanen 92/6: 164-165.
Gösta Svensson, Gustav (2021): Bliver det hvidt jul? 50 ton sneplove står klar. Ingeniøren, https://ing.dk
N.N. (2012): Klimasneplove. Lokomotivet 107: 22-23.
OH (1979): DSB bliver bedre rustet til de kommende vintre. DSBbladet Nr. 9/1979: 13.
Zur Fahrzeug-Übersicht





