| <<< vorhergehende Seite | zur Inhaltsübersicht | nächste Seite >>> |
4.1 Standorte
Stammwerk Chausseestraße:
August Borsig erwarb 1836-40 vor dem Oranienburger Tor Berlins einige weitgehend unbebaute Grundstücke. Diese bildeten eine zusammenhängende Fläche und nahmen den größten Teil des Areals ein, das heute von den Straßenzügen Chausseestraße, Torstraße, Borsig Straße und Tieckstraße eingefaßt wird. Dabei sicherte ein keilförmiger Ausläufer des Geländes die prominente Lage am Stadttor mit der Adresse "Chausseestraße 1" und nahm gleichzeitig dem Konkurrenten Egells den Raum zur Expansion. Sowohl die Anlieferung von Material und Brennstoff als auch die Auslieferung der Produkte erfolgte über den Zugang an der Chausseestraße mittels Pferdefuhrwerken von privaten Unternehmern. Ab 1841 erleichterte der nahegelegene Bahnhof der neuen "Stettiner Eisenbahn" die Transportverhältnisse.



Das erste Gebäude auf dem Werksgelände war 1837 eine von August Borsig selbst entworfene Gießhalle mit oktogonalem Grundriß und zwei Kupolöfen sowie Anbauten für die Formerei. Die Werkstätten für die Metallbearbeitung waren in Holzschuppen untergebracht, als Antrieb für die Werkzeugmaschinen diente ein Göpelwerk, das aus zweiter Hand bei Egells eingekauft worden war. Aber schon im Folgejahr arbeitete hier eine erste Dampfmaschine aus eigener Herstellung und neue, gemauerte Werkstätten entstanden. Bedingt durch die wachsende Produktion und ständige Anpassungen der Fertigungsprozesse herrschte eine rege Bautätigkeit, so daß sich die bebaute Fläche innerhalb von 5 Jahren vervierfachte. Kleinere Werkstätten und Lagerschuppen wurden an den Grundstücksgrenzen errichtet, um den Zugang zum Werksgelände und letztendlich auch die Einhaltung der Arbeitszeiten zu kontrollieren. Zu den größeren Neubauten zählten 1838 ein Kontorgebäude mit Turm, 1840 eine Kesselschmiede und ab 1844 Montagehallen für Lokomotiven. 1845 folgten zwei Wassertürme nach Entwürfen des Architekten Johann Heinrich Strack. Von diesen wurde der Uhren- und Wasserturm vor der Gießhalle als Wahrzeichen des Unternehmens aufwändig gestaltet, da er von der Chausseestraße aus offen sichtbar war. Der Turm mit oktogonalem Grundriß erhielt ein vorgelagertes Bassin, in das ein gußeiserner Löwe das Kühlwasser einer Dampfmaschine spie. Darüber stand in einem Zwillingsfenster die Figur eines Schmiedes von Gustav Bläser. 1846 folgten schließlich eine eigene Gasanstalt zur Beleuchtung der Firmenräume sowie 1848/49 ein Speisesaal und weitere Gebäude für soziale Zwecke. Damit endete im Wesentlichen die Bautätigkeit unter August Borsig im Werk an der Chausseestraße.
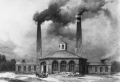

Nachdem Albert Borsig das Unternehmen 1854 geerbt hatte, konnte der Absatz von Lokomotiven deutlich gesteigert werden, was sich in einer Geländeerweiterung und dem Neubau verschiedener Fertigungshallen niederschlug. 1858 wurde ein hydraulisches Hebewerk eingerichtet, das innerhalb von 7 Minuten die 2,5 m Höhenunterschied zum Anschlußgleis der Stettiner Bahn an der heutigen Tieck- Ecke Borsigstraße überwand und die direkte Auslieferung der Loks per Schiene erlaubte. Auch das Erscheinungsbild des Unternehmens zur Chausseestraße wurde mit Bauten von Johann Heinrich Strack aufgewertet: 1858 entstand ein neues Verwaltungsgebäude mit hohem Turm, das 1860 durch eine Säulenhalle am Werkstor mit aufwändiger Ornamentik ergänzt wurde. Die Inzenierung der antikisierenden Motive sollte die Bedeutung des Unternehmens als zivilisatorische Leistung allegorische glorifizieren. Die repräsentativen Maßnahmen wurden 1862 mit der Aufstellung zweier Figurengruppen am Haupteingang zum Lobe von "Maschinenbau" und "Lokomotivbau" abgeschlossen. Damit war der Bauzustand erreicht, der auf den meisten zeitgenössischen Abbildungen zu sehen ist. Abgesehen vom Umbau einiger Werkstätten 1871-73 fanden keine weiteren Bautätigkeiten bis zur Stilllegung des Werkes 1887 statt. Nach der Schließung wurde die gesamte Bausubstanz abgetragen und das Gelände an die "Magdeburger Bau- und Creditbank" veräußert. Das ehemalige Borsiggelände wurde in Nord-Südrichtung durch die neu angelegte Novalisstraße geteilt und mit Wohn- und Gewerbeimmobilien bebaut.



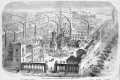

Ein Teil der Arkadenhalle und einige Schmuckelemente des neuen Verwaltungsgebäudes von 1858 blieben beim Abriß des Werkes erhalten und wurden 1901 im Garten der damaligen Technischen Hochschule Berlin aufgestellt. Das Baudenkmal gehört heute zum Campus der TU-Berlin und ist öffentlich zugänglich. Um der fortschreitenden Verwitterung zu begegnen, konzipierte das Büro "MTM Architektur" 2019 ein Schutzdach aus Glas und Cortenstahl, das bisher aber nicht realisiert wurde (Stand 2022).










Eisenwerk Moabit:
August Borsigs Pläne für ein eigenes Eisenwerk ließen sich aus Platzgründen nicht am Standort Chausseestraße realisieren. So erwarb er 1842 eine größere Fläche am nördlichen Spreeufer in Moabit, wobei er ein Areal von rund 3 Hektar für sein "Moabiter Gut" mit einem standesgemäßen Anwesen nebst Park vorsah. Das Gelände wurde von den heutigen Straßenzügen Alt Moabit, Stromstraße, Bundesratsufer und Bochumer Straße eingefaßt, spätere Zukäufe durch Albert Borsig erweiterten die Liegenschaft südlich bis zur Lewetzowstraße und westlich bis zur Elberfelder Straße.


Als erstes Betriebsgebäude in Moabit eröffnete August Borsig 1850 ein Walzwerk nahe der Spree. Das dazugehörige Kesselhaus erhielt einen markant gestalteten Schornstein mit einem aufgesetzten Kandelaber aus Gußeisen, der zu einer vielbeachteten Landmarke im Stadtbild wurde. Weitere Einrichtungen bestanden in einer freitragenden Halle mit Puddel- und Schweißöfen sowie einer Hammerschmiede, 1852 folgte der Kesselbau. Für die Arbeiter gab es eine Badehalle, deren Schwimmbecken mit Wasser aus der Spree befüllt und durch die Abwärme des Betriebes beheizt wurde. Das Werk fertigte Halbzeuge wie Bleche, Stangeneisen, geschmiedete Wellen etc. und belieferte in erster Linie die Lokomotivproduktion in der Chausseestraße. Nachdem Albert Borsig wesentliche Leistungen des Eisenwerkes an das schlesische Borsigwerk übertragen hatte, wurden aus der Lokfabrik Chausseestraße die Kessel- und Radschmiede nach Moabit verlegt, ab 1871 bestand ein Gleisanschluß zum Güterbahnhof Moabit an der Berliner Ringbahn.



Unter der folgenden Verwaltung des Nachlaßkuratoriums wurde 1895 am südlichen Ende des Werksgeländes eine Dampfmühle errichtet, die als "Borsigmühle" bekannt wurde. Die Anlage wurde an die "Berliner Dampfmühlen-Aktiengesellschaft" verpachtet und bereits 1898 bei einem spektakulären Brand zerstört. 1887 wurden die Reste des Lokomotivbau nach Moabit verlegt und mit dem Bau des neuen Borsigwerkes in Tegel gingen 1898 schließlich alle Abteilungen dorthin. Der Standort Moabit wurde geschlossen und die Liegenschaft an die eigens gegründete "Neu-Bellevue-Aktiengesellschaft für Grundstücksverwertung" abgegeben. Diese trug die gesamte Bausubstanz ab, parzellierte das Gelände zum Bau von Wohnhäusern und legte neue Straßen an, sodaß hier ab 1905 hier das "Westfälische Viertel" entstand. Von dem Borsig Eisenwerk in Moabit blieb nichts erhalten und nicht mal eine Gedenktafel erinnert an die Geschichte des Geländes.
|
Box: Borsighalle Als einziges Relikt des Eisenwerks Moabit blieb der Prototyp der innovativen Gitterhalle für die Puddel- und Schweißöfen erhalten: August Borsig hatte ab 1847 eine freitragende Halle ohne Mittelstützen entwickelt, die aus seriell vorgefertigten Gitterträgern aufgebaut war. Die Trägerstruktur war aus vernieteten Eisenelementen zusammengesetzt, das Dach mit aufgesetztem Oberlicht bestand aus Brettern und war mit Dachpappe gedeckt. Eine solche Halle war nach Bedarf in der Länge skalierbar und ließ sich bei Bedarf an neue Standorte versetzen. Die Konstruktion diente als Vorbild für gleichartige Bauwerke wie die Londoner St. Pancras Station oder die Bahnhofshalle Berlin-Alexanderplatz. Der 1849 fertiggestellte Prototyp wurde beim Abriß des Werkes in Moabit 1899 demontiert und in Eberswalde auf dem Gelände der Eisenspalterei am Finowkanal neu aufgebaut. Ab 1993 stand die "Borsighalle" in Eberswalde leer und verfiel, bis sie 2014 als Urtyp aller stützenlosen Hallenkonstruktionen in die Liste der "National wertvollen Kulturdenkmäler" eingetragen wurde. Innerhalb von 7 Jahren wurde für rund € 2,8 Mio das gußeiserne Tragwerk mit einem aufwändigen Korrosionsschutz saniert und das Dach erneuert. Die Arbeiten waren im Frühjahr 2021 abgeschlossen, ein Nutzungskonzept stand noch aus (Stand 2023). 






|
Maschinenbauanstalt Moabit "Seehandlung":
Nach längeren Verhandlungen übernahm August Borsig 1850 die Maschinenbauanstalt der "Preußischen Seehandlungs-Sozietät" in Berlin Moabit inklusive der Belegschaft von rund 300 Mann. Das Unternehmen wurde betriebsintern als "Seehandlung" bezeichnet und lag in nächster Nachbarschaft zum Borsig´schen Eisenwerk zwischen Kirch- und Calvinstraße. Nach Süden grenzte das Grundstück an die Spree, nach Norden an den noch unbebauten "Karnickelberg" in Alt-Moabit. Borsig nutzte den Standort zum Bau stationärer Maschinen und Schiffsdampfmaschinen sowie zur Fertigung von großen Gußstücken und Hochbaukonstruktionen. Hier wurden u.a. die Einzelteile der Kuppeln für das Berliner Stadtschloß und die Nicolaikirche in Potsdam sowie ein Schwimmdock für Swinemünde mit einem Gewicht von 7.100 t gefertigt. 1896 wurde die Seehandlung geschlossen und das Gelände an die "Magdeburger Bau- und Credit-Bank" veräußert. Die Liegenschaft wurde durch die neu angelegte Thomasiusstraße aufgeteilt und für die Bebauung mit Wohnhäusern parzelliert. Die alte Bausubstanz wurde abgetragen und alle Spuren des vormaligen Industriestandortes getilgt.
|
Box: Königliche Seehandlungs-Sozietät Der preußische König Friedrich der Große gründete 1772 die "Generaldirektion der Seehandlungs-Sozietät" die mit eigenen Schiffen international aktiv werden und die preußische Staatskasse füllen sollte. Als Staatsunternehmen erhielt die Seehandlungsassozietät bald darauf auch das Recht, Finanzgeschäfte durchzuführen und in Gewerbe zu investieren, um so den Aufbau eines privatwirtschaftlichen Unternehmertums in Preußen zu fördern. Das Institut war Anfang des 19. Jahrhunderts vorrangig mit der Verwaltung der Staatsschulden im Zuge der napoleonischen Kriege befaßt und wurde 1820 zu einem unabhängigen Geld- und Handelsinstitut des Staates. Man unterstützte nun die Industrialisierung Preußens durch Investitionen in Unternehmen und Infrastruktur wie Eisenbahnen, Straßen und Dampfschifffahrt. Einer dieser Betriebe war die 1836 eröffnete "Maschinenbauanstalt der Königlichen Seehandlung" in Berlin Moabit, wo mit dem Raddampfer "Prinz Carl" das erste vollständig aus Eisen erbaute Schiff in Deutschland vom Stapel lief. Darüber hinaus wurden Sozialeinrichtungen wie Kranken- und Invalidenkassen eingeführt, Gewerbeschulen gegründet und die Grundlagenforschung gefördert. Das wirtschaftliche Engagement der Seehandlungssozietät wurde 1845 beendet, da sie zunehmend als Wettbewerber für die aufstrebenden privaten Unternehmen gesehen wurde. Die einzelnen Betriebe wurden verkauft, das Institut selbst ging in der preußischen Staatsbank auf und firmierte ab 1904 als "Königliche Seehandlung (Preußische Staatsbank)". 1930 wurde diese vom Preußischen Landtag als "Preußische Staatsbank (Seehandlung)" zu einer rechtsfähigen Anstalt öffentlichen Rechts mit eigenem Vermögen erklärt und 1947 schließlich durch den Alliierten Kontrollrat aufgelöst. Aus dem Restvermögen konstituierte das Land Berlin 1983 die "Stiftung Preußische Seehandlung" zur Förderung von Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur. |
| <<< vorhergehende Seite | zur Inhaltsübersicht | nächste Seite >>> |





